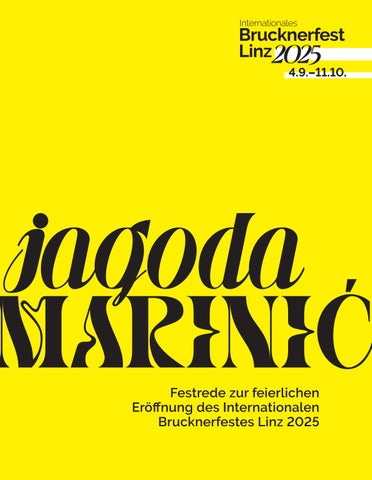Jagoda Marinić
Sehen, was noch nicht ist
Festrede zur feierlichen Eröffnung des Internationalen Brucknerfestes Linz 2025
Sehen, was noch nicht ist
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Hörens, des Sehens und des Brucknerfestes!
Es ist besonders, ein Musikfestival mit Worten zu beginnen – und dabei in diesem Jahr den Schwerpunkt nicht auf das Hören, sondern das Sehen zu richten: Augen auf, Musik!
Es ist mir eine große Ehre, heuer unter diesem Motto hier zu sprechen, so wie es eine Freude war, in den Wochen zuvor die Reden der eindrucksvollen Persönlichkeiten zu lesen, die vor mir hier sprechen durften. Mit jedem erlesenen Festivaljahr der Vergangenheit verstand ich besser, was hier Jahr um Jahr gehört wurde, welche Themen die Menschen, die dieses Festival gestalten, ins Sichtfeld hoben. Dieses Jahr steht das Sehen selbst im Sichtfeld – fast ein Vexierspiel, wenn das Auge selbst zum Motiv wird. Was sieht es? Wer oder was sieht zurück?
Es ist ein Festival zwischen Tradition und Vision, so viel habe ich verstanden. Ein Ort des Nachdenkens und Nachspürens, was gestern war und was morgen sein sollte, wenn die Werte von gestern auch heute in Wert gesetzt werden sollen. Und das sollen sie, sonst säßen wir am heutigen Morgen nicht gemeinsam in diesem Konzertsaal.
Ich stehe hier nun mit meiner Rede im Jahr 2025. Für einige im Saal – so viel biografische Einordnung traue ich meinem sehenden Auge zu – muss es eine Zeit gegeben haben, da sahen Sie, wie ich selbst, diese Zahl und dachten an eine Zeit der Zukunft.
2025 – das hätte ein Jahr werden können, in dem Neues, Ungehörtes und Ungesehenes Platz findet. Ich zumindest habe mir die Zukunft anders vorgestellt. Diese einst vor-gesehene Zukunft ist nun zur Gegenwart geworden und vieles, was über die Weltlage zu hören und zu sehen ist, entpuppt sich eher als rückwärtsgewandt denn als futuristische Neuerung. Es ist uns in dieser einst imaginierten Zukunft, die nun Gegenwart ist, nicht die Demokratie neu geboren worden – so sieht es derzeit aus.
Es gibt, obgleich wir technologische Fortschritte machen, wenige Indizien für eine digitale Demokratie 2.0, die mehr Gerechtigkeit bringen könnte als die bisherige. Stattdessen deutet das meiste, was im digitalen Raum geschieht, auf Manipulation der Demokratien, auf eine Versklavung des Sehens. Wir erleben statt einer Zukunft, die zivilisatorische Neuerungen bringt, ein Wiedererstarken autoritärer Kräfte. Sie kommen Hand in Hand mit den neuen Oligarchen, den digitalen Bros, ›Broligarchen‹ genannt. Deren Produkte halten wir inzwischen stundenlang in den Händen, streichen über Glasflächen statt Haut, täglich. Die ›Broligarchen‹ bestimmen zunehmend, wie wir die Welt sehen, weil wir sie über unsere Handydisplays betreten.
Es ist 2025 und noch immer werden Kriege gekämpft. Der Hunger vieler Menschen wurde nicht gestillt, alles Themen, die meine Vorrednerinnen und Vorredner hier schon ins Licht gesetzt haben. Es herrschen nicht nur Kriege weltweit, es herrscht auch wieder Krieg in Europa. Dreißig Jahre nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien, achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges müssen wir 2025 darüber diskutieren, ob Soldaten in die Ukraine gesendet werden und was die neue Weltordnung ist ...
Die Zukunft, die unsere Vorfahren sich mit dem Friedensprojekt Europa vorgestellt hatten, war kurze Zeit Gegenwart und lässt nun wieder auf sich warten. »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch«, sagte Brecht. Auch das hielten wir für Gestern. Wir haben das Tyrannisieren jedoch nicht überwunden als Menschheit.
Ich könnte jetzt noch mehr der gegenwärtigen Herausforderungen aufzählen, uns ordentlich zusammenfalten, da wir, gerade in kulturellen Kontexten, gut geübt sind darin, Hoffnungslosigkeit mit kritischem Denken gleichzusetzen. Stattdessen möchte ich Sie an dieser Stelle einladen, vor Ihrem inneren Ohr und Auge die Musik Bruckners spielen zu lassen. Ich wünsche mir, wenn ich so viel Wunschraum in Ihrem Innenleben für einen Moment beanspruchen darf, dass seine Musik in Ihnen erklingt, vor Ihrem inneren Ohr und Auge. Sie spüren, wie sich trotz der lähmenden Schlagworte unserer Unzeit, die ich eben aneinandergereiht und ausgesprochen habe, jetzt nicht alles verdunkelt; sondern Sie mit Ihrer Vorstellungskraft allein, der Vorstellung, Bruckners Musik zu hören, das Magische zulassen: Ihr Blick richtet sich zum Himmel, Licht fällt ein, weil sie spüren, wie sie innerlich sehend auch hören können, weil dieses innere Sehen kraftvoller Klänge ein Geheimnis des menschlichen Gehirns ist: Wir sehen und hören, bis eine andere Wirklichkeit möglich wird.
Das, meine Damen und Herren, geschah zumindest vor meinem inneren Auge, als ich während des Schreibens dieser Rede Bruckners Musik anspielte. Noch lieber als Bruckner beim Schreiben nebenher zu hören, spielte ich ihn immer wieder neu an, weil die Schwelle, über die seine Musik mich trägt, eine eigene Faszination ausübt, als gäbe es ein Dort über das Hier hinaus. Als würde man ein musikalisches Bild
sehen, das einem die Kraft gibt, in schwierigen Zeiten wie diesen etwas Überhöhtes zu sehen, etwas Mutiges zu wagen, im Denken einen Anspruch an die Welt zu stellen. Bruckner immer wieder aufs Neue anzuspielen, fühlte sich jedes einzelne Mal für mich an, wie in Rom ins Pantheon zu treten. Sie kennen das vielleicht: Noch faszinierender, als sich im Pantheon umzusehen, ist der Moment, in dem man den Raum betritt und sich fragt: Wie kann das Licht auf diese Art in die Dunkelheit fallen? Wie? Es ist diese Art der Disruption des Gewöhnlichen, in der das eigentliche Sehen beginnt, weil wir etwas sehen, das wir zuvor noch nicht für möglich hielten, zumindest nicht in dieser Schönheit oder Klarheit.
Was für eine starke Metapher ist das Sehen von Musik, das dieses Jahr im Mittelpunkt steht, denke ich plötzlich, weil die Erfahrung, den Geist zu weiten, eine der dringlichsten dieser Zeit ist. Gerade weil so viele Menschen nachts im Bett liegen, selbst nebeneinander oft allein, in ihr Handy starren und eben nicht in die innere Weite sehen, sondern in die algorithmische Verengung (der Welt).
Wir sprechen in diesen Zeiten und Kontexten wie diesen ausgiebig über die Bedrohungen für unsere demokratischen Gesellschaften. Wir sind alarmiert und wir alarmieren. Auch Festreden wie diese, unsere wertvollen gemeinsamen Stunden, verwenden wir oft auf die Beschreibung der Bedrohungs- und Krisenszenarien, als würden wir danach umgehend durchgeschüttelt aufstehen und die Welt verändern. Als würden wir, je schwärzer jemand die Gegenwart malt, je größer den Gegner, desto eher unseren Beitrag leisten. Doch was, wenn es sich umgekehrt verhält? Was, wenn wir auch hier diese Schwellen finden und übertreten lernen müssen, die uns wieder etwas Erhabenes sehen lassen, weil das Licht einfällt?
Ich möchte daher den heutigen Morgen nicht nur dafür nutzen, uns zu vergegenwärtigen, wie viel Grauen auf dieser Welt zu sehen war und ist, sondern ich möchte dieses Privileg des Zusammenkommens, das wir heute hier in Linz genießen –nämlich in Frieden darauf zu warten, gemeinsam Musik zu hören – dafür nutzen, gemeinsam die Schönheit der menschlichen Schöpfungskraft zu sehen. Warum kommen wir hier zusammen? Weil es uns an die Schönheit erinnert. Weil diese Schönheit den Glauben in uns erneuert.
Das muss nicht der Glaube an Gott sein, aber daran, dass etwas da ist, vielleicht sogar eine gewisse Ordnung der Dinge, wenn es in dieser Schönheit angelegt werden kann durch den Menschen. Wie könnte mir in Worten auch nur annähernd das gelingen, was uns durch das Hören von Bruckners Musik gelingt? Was verbindet unser beider Schaffen? Er verführt Sie über Klänge dazu, das Pantheon zu betreten und nach dem Licht zu suchen. Ich versuche es über Worte. Beides setzt voraus, innerlich Bilder zuzulassen. Wie also kann ich Sie, meine Damen und Herren, auch angesichts der Konvention, dass wir zu solchen Anlässen auch die Notwendigkeit des kritischen
Denkens feiern, in dieser Zeit zugleich an die Schönheit erinnern – auf dass diese in Ihnen und durch Sie vervielfältigt würde?
Ich spreche zu vielen Anlässen und über Themen, die im Moment Rechtsaußenbewegungen für sich beanspruchen. Ich fühle mich inzwischen, als wäre alles längst gesagt worden. Ich möchte das so nicht mehr tun, wie ich und viele andere es die letzten zwanzig Jahre getan haben, denn es hat nicht die Zukunft gebracht, für die wir eingestanden sind. Das kann natürlich noch werden, nicht immer entfaltet sich demokratische Arbeit direkt und unmittelbar, doch zum jetzigen Zeitpunkt muss man feststellen: Eine gerechtere Gegenwart ist nicht geworden.
Ich möchte daher unsere Zeit nicht mehr mit Dagegen-Anreden verbringen, weil ich zunehmend den Eindruck habe – um bei Brechts Bild vom Schoß zu bleiben –, wir könnten dadurch unwillkürlich zu Geburtshelfern werden, das Schreckliche aus dem Schoß wieder mit in die Welt zu bringen: Die Inhumanität. Die Empathielosigkeit. Die Kälte. Die maßlose Habgier. Oft lassen wir Räume wie diese inzwischen zu Kampfräumen mutieren, um gegen Totalitarismus und Autoritarismus anzureden.
Doch im Kampf gegen diese Kräfte bestärken wir auf paradoxe Weise auch deren Kampf. Wir reden – selbst wenn wir diese Ideen ablehnen – über reaktionäre Ideen und die Menschenverachtung, die manchen von ihnen zugrunde liegt. Wir verbreiten sie. Wir nehmen die Schönheit aus dem Sichtfeld, den Anspruch, die Utopie, dass mehr sein könnte, als nur den Rückschritt zu verhindern.
Wir gestatten, dass in gemeinschaftlichen Räumen menschenverachtende Töne erklingen, inhumane Bilder vor unserem inneren Auge entstehen, weil wir es gut meinen. Doch wir vergessen dabei den Anspruch, den Bruckner an seine Musik und an seine Hörer stellte, nämlich über das Alltägliche hinaus zu sehen, mit der Vorstellungskraft gen Himmel zu reisen und seine unendliche Weite gedanklich zu greifen.
Wir reden seit geraumer Zeit in öffentlichen Räumen vorwiegend über den Angriff auf die Demokratien. Doch wie oft reden wir über das Kollaborieren, über das Bedürfnis der Menschen nach anderen Menschen, über unsere Abhängigkeiten voneinander? Ich habe in meinem letzten Buch die Idee der ›Sanften Radikalität‹ als Haltung im Miteinander formuliert, das meint letzten Endes das Sehen des Gegenübers, das Hören des anderen, das Vertrauen in das Ich und Du. In den Klangkörper, den wir erzeugen, wenn wir den anderen wirklich sehen.
Wie kann es gelingen, visionäre Bilder und Gedanken in eine Gesellschaft hineinzutragen, die so mit ihren Unzulänglichkeiten beschäftigt ist? Wie lassen sich unsere Synapsen anregen, anstecken, etwas zu erdenken, was noch nicht ist, das aber radikal besser sein könnte, als das, was heute ist? Um das zu leisten, müssen wir es wagen, zu sehen, was noch nicht ist.
Demokratien entstehen und leben vom Motor der guten Ideen: Es herrschte Unfreiheit, man versprach den Menschen Freiheit, Freiheit erschien vielen erstrebenswerter –und so begann der Kampf für sie. Freiheit ist für mich ein Wort, das wie das Licht ins Pantheon in ein Zeitalter der Unterdrückung fiel. Bis heute fällt es in jede Kultur der Unterdrückung und entlarvt diese. Ist das Licht einmal da, sehen die Menschen die Bedingungen ihres Seins anders. Sie sehen die Möglichkeit, würdig zu leben. Die Freiheit, die viele heute für selbstverständlich erachten, musste hart und blutig erkämpft werden. Doch zunächst musste diese Utopie der Freiheit von jemandem innerlich gesehen und beschrieben werden, obwohl sie noch nicht zu sehen war im Außen. Wir müssten es heute nur schaffen, den Wert dessen zu sehen, was bereits vorgedacht worden ist, und schon diese Vorstellungskraft bringen viele nicht mehr auf.
Was ist das heutige Versprechen, das demokratische Gesellschaften geben, für das es sich zu kämpfen lohnt? Ein aufrichtiges Versprechen wird in Demokratien schon viel zu lange nicht mehr gegeben. Wir verlieren selbst unsere vergangenen Ansprüche aus dem Blick, sonst sähen wir nicht weg, wenn im Mittelmeer vor diesem humanistischen, aufgeklärten Europa Menschen ertrinken. Wir sähen nicht weg, wenn Menschen Angst haben, ob sie sich ihre Wohnungen noch werden leisten können. Es ist das Weg-Sehen, mit dem wir unsere Demokratien aushöhlen, das Nicht-Handeln, das sich aus diesem Wegsehen ergibt.
Reaktionäre füllen unterdessen den ausgehöhlten Raum mit Unversprechen. Demokratische Kräfte treffen sich dann wieder, um sich gegenseitig zu versichern, das gesellschaftliche Miteinander könne nicht durch Brachialegoismus gerettet werden. Sie setzen dem jedoch nicht genug entgegen. Donald Trump und seine ›Broligarchen‹, von Peter Thiel über Elon Musk bis Jeff Bezos, hatten ein Projekt 2025. Das ist derzeit aus unserer Zukunft von einst geworden. Wo ist die Vision, wo ist die Idee der Anti-Trumpisten, der Anti-Autoritären, der Pro-Demokraten? Wir wollen das Schlimmste verhindern, aber wir haben verlernt, mehr zu sein als Anti-Trumpisten. Wir haben verlernt, die Räume, die wir schaffen, zu nutzen, um neue Ziele vor-zu-sehen, neue Werte sichtbar zu machen, die eine stärkere Anziehungskraft ausüben als die nostalgische Sehnsucht nach gestern.
Ich habe Träume. Ich hatte immer Träume und ich habe Angst vor einer Zeit, in der wir der Jugend eine Welt zumuten, in der sie nicht einmal mehr träumen kann. In der es dann Rechtsextreme sind, die dieser Jugend einen Traum von vermeintlicher Stärke angesichts unserer Schwäche verkaufen. Pseudostärke, die plausibler wirkt als das, was das humanistische Weltbild anzubieten hat – denn wir stehen inzwischen da wie die Traumlosen. Viele sind im Moment nicht mehr zum Träumen zu erwecken. Für den Traum von einem besseren Morgen, für den wir kämpfen würden. Nichts scheint mir in dieser Zeit wichtiger, als in den Spiegel zu sehen, und zwar ohne Filter, um zu erkennen, wer wir sind.
Da bin ich schon wieder, und blicke in den Abgrund, den man leicht Verzweiflung an der Fortschrittslosigkeit der Zivilisation nennen kann. Gestatten Sie mir noch einmal, Sie einzuladen, mir in Ihrem inneren Auge zu folgen. Stellen Sie sich vor, wie ich im Sommermonat August diese Rede für Sie schreibe: Ich sitze an meinem Schreibtisch in der Hitze Dalmatiens, jetzt, da ich eben diese Stelle schreibe, lasse ich Bruckner spielen. Ich höre seine Musik, es braucht nur wenige Töne, bis ich sehe, wie mein Geist in einen Raum tritt, so körperlich wie das Pantheon in Rom. Ich hebe den Kopf, sehe den Oculus. Es muss etwas geben, das größer ist als die Resignation. Eine Öffnung, durch die das Licht fällt. Es ist möglich, diesen Raum zu betreten, wenn wir es wagen, über Schwellen zu gehen, wir dürfen nur nicht davon ablassen, vor der Resignation zu fliehen. Wir dürfen das, was ist, nicht als Grenze sehen, sondern sollten die Offenheit bewahren, es als mögliche Schwelle zu sehen. Johannes Brahms schreibt am 12. Januar 1885 über Bruckner: »Alles hat seine Grenzen. Bruckner liegt jenseits ...«
Es ist diese Haltung in Bruckners Werk, diese Fluchtbewegung, die ihn zur Musik führte, die uns an die Kraft in uns erinnert. Es ist diese Flucht zum kraftvollen Schaffen, durch die ich mich ihm verbunden fühle. Wir alle können durch das Sehen seiner Musik dorthin gelangen. Er schafft mit seiner Musik einen Raum, in dem wir neu sehen, uns anders ins Verhältnis setzen können zu uns selbst und zur Welt und zur Möglichkeit der Unendlichkeit. Amen.
Ich nehme mir mit solchen großen Sätzen die Freiheit, eher mit den Augen einer Spätromantikerin als den Augen einer modernen Kritikerin zu hören. Sie mögen es mir hoffentlich nachsehen. Wenn nicht, sehe ich es Ihnen nach.